Datenbank des MikAlp Projekts
Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR-) Imaging
FTIR-Imaging zur Charakterisierung von Mikroplastik
Was ist FTIR-Imaging?
Die Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR) mit bildgebender Detektion – kurz FTIR-Imaging – ist eine etablierte Methode zur chemischen Identifikation und Quantifizierung von Mikroplastikpartikeln in Proben. Dabei wird die Verteilung von Partikeln auf einer Filteroberfläche erfasst und durch ortsaufgelöste Infrarotspektren analysiert. Die Grundlage bildet die Wechselwirkung von Infrarotstrahlung mit den Schwingungen spezifischer Molekülbindungen, wodurch eine eindeutige Zuordnung zu polymeren Materialien möglich ist.
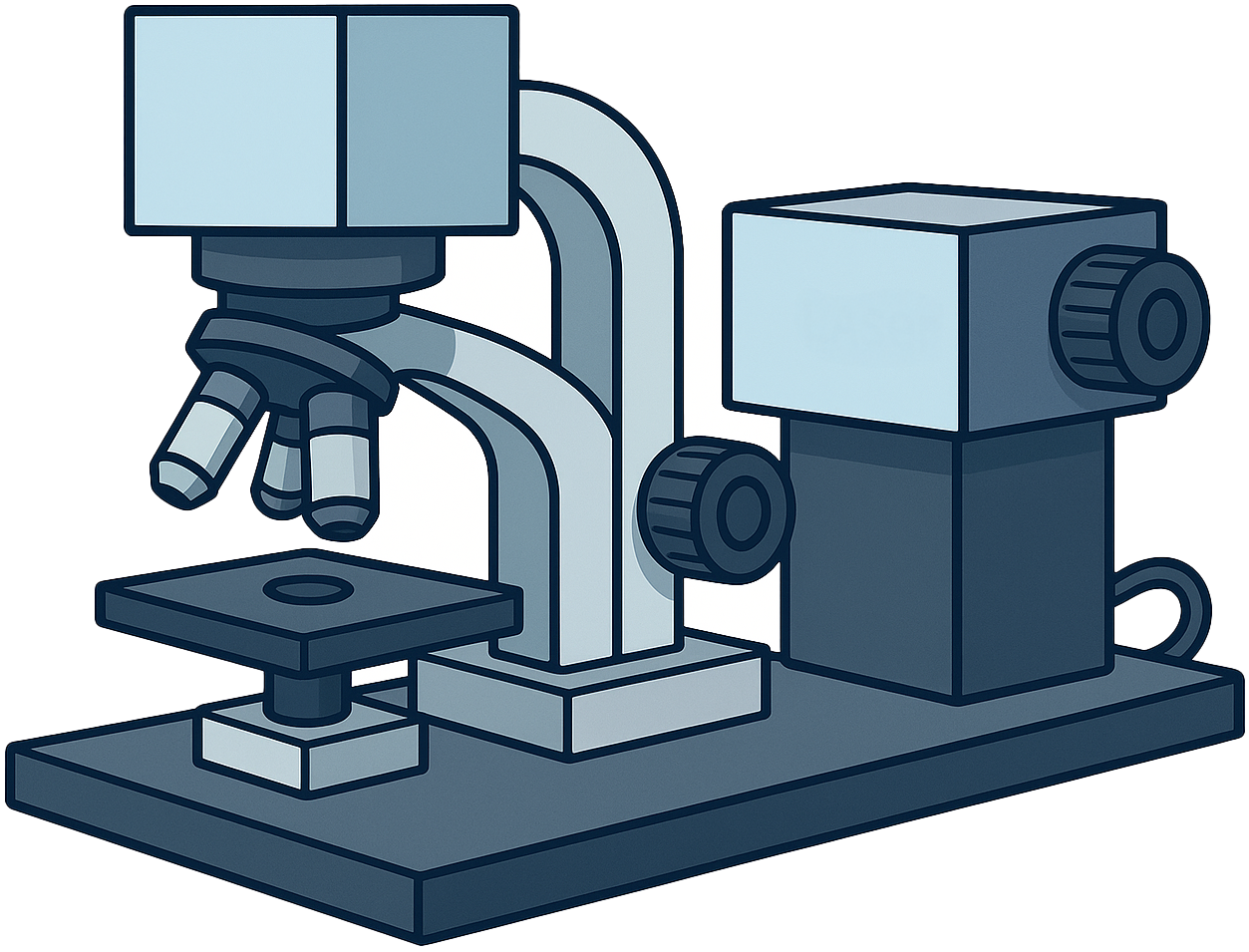
Wie läuft eine typische Messung ab?
Die Probe wird durch Filtration auf reflektierende (gold- oder aluminiumbeschichtete Membranfilter) oder IR-transparente Filtermaterialien (Anodisc®) aufgebracht. Nach Trocknung wird zuerst ein optisches Bild des Filters aufgenommen und anschließend die gesamte Filterfläche mithilfe eines Detektors rasterartig vermessen. Dabei werden für jedes Pixel vollständige IR-Spektren aufgenommen. Die Wahl der räumlichen Auflösung (typisch 25 µm oder 6.25 µm) beeinflusst maßgeblich die Nachweisgrenze und die Messdauer.
Im Anschluss erfolgt die automatisierte Spektrenauswertung mithilfe von Referenzdatenbanken: Jedes Pixel wird hinsichtlich polymer-typischer Absorptionsbanden klassifiziert und die detektierten Partikel hinsichtlich Größe, Anzahl und chemischer Zusammensetzung erfasst. Hierbei können auch Methoden basierend auf Machine-Learning (Artificial Intelligence) zum Einsatz kommen.
Gewonnene Informationen
FTIR-Imaging liefert eine Vielzahl relevanter Daten über die Morphologie als auch die Identität Mikroplastikpartikel in der Probe:
Chemische Identifikation von Polymeren (z. B. PE, PP, PS, PET, PVC etc.)
Partikelanzahl pro Polymerklasse
Partikelgrößenverteilung
Morphologische Informationen (Farbe, Form, Größe, etc.)
Limitationen, Vorteile und Nachteile
Ein wesentlicher Vorteil der FTIR-Imaging-Technologie liegt in der Möglichkeit, große Probenflächen automatisiert und mit hoher spektraler Aussagekraft zu analysieren. Auch dunkle oder teiltransparente Partikel können unter geeigneten Bedingungen detektiert werden. Schwierigkeiten bestehen jedoch häufig bei schwarzen oder sehr dunklen Partikeln, wobei hierbei die Infrarot-Strahlung vollständig vom Partikel absorbiert wird und (im Falle einer Transmissionsmessung) kein Licht mehr den Detektor erreicht. Die Methode ist nicht-destruktiv und erlaubt eine rückführbare Dokumentation aller Einzelspektren.
Zu den Einschränkungen zählen ein erhöhter Zeitaufwand bei hoher räumlicher Auflösung sowie Limitierungen hinsichtlich der Nachweisbarkeit sehr kleiner (<10 µm) Partikel. Zudem erfordert die Auswertung eine geeignete Referenzdatenbank und Erfahrung in der spektralen Interpretation.
